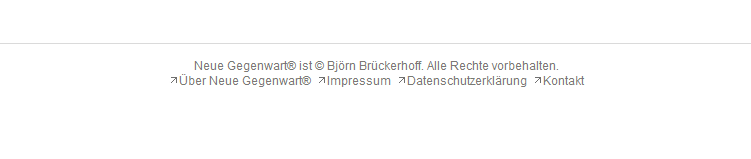|

NETZWERK VERGANGENHEIT
Geteiltes Leid ist halbes Leid
TEXT:
 STEPHAN ISERNHAGEN STEPHAN ISERNHAGEN
BILD:
©
BERLINER LANDESARCHIV
Ein Ost- und ein Westdeutscher
sind eng aneinander gebunden, sind sich aber nie begegnet. Ihre Leben drehen sich
um die Gedenkstätte Hohenschönhausen, dem Stasi-Knast in Ost-Berlin. Sie
erzählen vom 17. Juni und von sich selbst.
2003 ist der 17. Juni 50 Jahre her.
In jenen Junitagen des Jahres 1953 erlebt die DDR einen machtvollen
Volksaufstand, der sich gegen das harte SED-Regime richtet. Die DDR unter
Walter Ulbricht: Trotz Stalins Tod im März halten die DDR-Oberen an
ihrem stalinistischen Kurs fest. Sie beschliessen,
dass alle DDR-Arbeiter 10 Prozent mehr arbeiten müssen – für den gleichen
Lohn. Doch nach dem Tode des sowjetischen Diktators beginnt in der
Sowjetunion das politische Tauwetter. Walter Ullbricht und Otto Grotewohl
werden nach Moskau zitiert, müssen ihr politisches Programm ändern. Das
machen die beiden auch. An den Arbeitsnormerhöhungen halten sie aber fest.
Die Lage spitzt sich zu: Schon vor dem 17. kommt es zu ersten Streiks und
Arbeitsniederlegungen. Die Arbeiter fordern „Weg mit den Normen“. Im Verlauf
des 17. Junis wird aus den spontanen Streikbewegungen eine demonstrierende
Menschenmasse. Auf den Transparenten stehen Parolen, die bald nicht nur
wirtschaftliche Missstände aufgreifen, sondern politischer Couleur sind.
„Weg mit Ullbricht!“, „Hängt Ullbricht auf!“ und „Weg mit der Regierung!“.
50 Jahre sind vergangen und
einige der Männer, die damals auf die Straße gingen, leben immer noch in
Berlin. Ihre Leben kreuzten sich am 17. Juni und dann nie wieder. Dennoch
sind sie auf unterschiedliche Weise gebunden an ihre Vergangenheit – Es gab
ein Leben nach dem 17. Juni.
Die Opfer des 17. Juni liegen in
schwarzen Särgen vor dem Schöneberger Rathaus. Männer, mit denen der
19-jährige Herbert P. vor sechs Tagen gegen das SED-Unrechtsregime
demonstrierte. Bundeskanzler Konrad Adenauer spricht zu den Trauernden.
Hunderte verharren minutenlang, nehmen schweigend Abschied.
Ost-Berlin am 17. Juni: Gerhard
F. verbringt die Nacht mit acht anderen Demonstranten im geheimen
Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, in einer acht Quadratmeter Zelle. Durch
dicke Glasbausteine schimmert nur wenig Licht. Dem 16-Jährigen ist kalt, er
kriecht unter Stroh und einen löchrigen Kartoffelsack. Erst vier Tage später
darf er sich waschen und satt essen.
Nach 50 Jahren wohnen Herbert P. und Gerhard F. wie damals in Berlin. Der
eine im Osten. Der andere im Westen. Sie leben im geeinten Deutschland, sind
aber doch in verschiedenen Welten zu Hause.
Alltag in Berlin
Herbert P. zieht kräftig an einer Zigarette. Er sitzt in einem 20
Quadratmeter-Raum in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Die Wände sind weiß
gestrichen – keine Bilder, Kunstblumen in einer grünen Plastikvase auf
einem wackligen Holztisch. Tief im Osten an der Genslerstraße führt Herbert
P. seit sieben Jahren jeden Tag bis zu vier Gruppen durch das alte
Stasi-Untersuchungsgefängnis. Er selbst saß in einer der Zellen ein. 1954:
Weil er am 17. Juni dabei war.
Im Gang vor dem Aufenthaltsraum hängen Fotos jener ehemaligen Häftlinge, die
heute Gruppen durch die Gedenkstätte führen. An denen von Herbert P. steht:
„Die Zellentür klackte hinter mir zu und ich dachte: Hier kommst du nie
wieder raus.“ Plötzlich trampeln 30 Schüler durch den Gang, Herbert P.
schaut nicht einmal hoch. „Die Gedenkstätte ist wie ein zu Hause für mich.
Ich kenne jeden Raum, gehe jeden Tag durch die langen Zellentrakte. Ich muss
doch weitergeben, was hier passierte“, sagt der 69-Jährige. Mit seinen
dunkelbraunen Augen schaut er durch das kleine Fenster. Noch immer
durchkreuzen rostige Gitterstäbe seinen Blick nach draußen.

Den Blick nach vorn, den Kopf durch einen Motorradhelm geschützt, so
knattert Gerhard F. mit seinem lilafarbenen Roller über die holprige Straße
am Gefängnis vorbei. Der 66-Jährige ist auf dem Weg zum „Allee Center“,
einer Einkaufspassage. Dort trinkt er jeden Morgen einen Kaffee im „Backstop“.
Ab und zu nimmt er eine Vanilleschnecke. Am liebsten mit viel Zucker.
„Meine Frau Brigitte schmeißt mich um zehn Uhr aus der Wohnung.“ 65
Quadratmeter teilt er sich mit ihr und Sohn Mario. Elf Stockwerke hoch ist
der Plattenbau. Über 40 weitere reihen sich an der Pablo-Picasso-Strasse im
Osten Berlins aneinander. Nur wenige Minuten entfernt liegt Hohenschönhausen
– jeden Tag fährt Gerhard F. an den ockerfarbenen Mauern mit dem
Stacheldraht vorbei. Der 17. Juni ist für ihn Vergangenheit: Die bittere
Zeit im Gefängnis, der Hunger, die Schläge der Stasi. „Eines Tages habe ich
alle meine Akten über den 17. Juni in den Müll geworfen, weil ich mich nicht
jeden Tag erinnern will.“
Für Herbert P. ist der 17. Juni zum Alltag geworden. In seinen Führungen
geht er nur in Stichworten auf die Vorgeschichte ein, beleuchtet dann die
wesentlichen Ereignisse. Manchmal wirkt er müde, abgeschlafft. Über die
Haftbedingungen im Untersuchungsgefängnis spricht er ungern. Wenn er doch
muss, fällt es ihm schwer: Er drückt seinen Oberkörper gegen die Stuhllehne,
stemmt die Arme gegen die Tischkante. Das starre Holzgestell gibt nicht
nach. Dann stützt er sich auf den Tisch, zieht kräftig an der Zigarette.
Er bleibt einsilbig. Mit routinierten Redewendungen wie „Die Arbeiter zogen
durch Berlin“ und „Der 17. Juni ist ein wichtiger Tag“ beschreibt er die
Ereignisse. Die Besucher, die er durch das Gefängnis führt, fragen nicht
nach. Sie schauen sich die Zellen und die Folterkammern an. Tourismus der
etwas anderen Art.
Rückblick
Die Arbeiter ziehen vom Stahlwerk Hennigsdorf über Tegel, die
Friedrichs- und Wilhelmstraße hoch. Ihre Parolen dringen in das Schlafzimmer
von Herbert P., reißen auch seine Mutter und seine Schwester aus dem Schlaf.
Der junge Maschinenschlosser ärgert sich, weil er Urlaub hat und ausschlafen
will. Als er aber vom Küchenfenster aus die Transparente der Arbeiter sieht,
folgt er neugierig den vorbeiziehenden Menschen. „Je näher wir zum Haus der
Ministerien kamen, desto radikaler waren unsere Forderungen.“ Durch die
Wilhelmstraße zieht er zum Potsdamer Platz. Der Junge ist berauscht vom
Augenblick, gefangen in der Dynamik der marschierenden Menschen. Ihm wird
warm, er schwitzt, er stimmt ein in den Chor der Protestrufe, schreit „Hängt
Ulbricht auf!“ und „Weg mit der Regierung!“ Endlich kann der junge Mann aus
dem Berliner Westen gegen das Unrechtsregime auf die Straße gehen und sein
Mitgefühl zeigen für die Menschen im Osten der Stadt, den die Machthaber
auch den „demokratischen Sektor“ nennen. „Denen ging es doch so dreckig.“
An einer Straßenecke traut er sich, zwei DDR-Fahnen von einem Mast zu reißen
und sie anzuzünden. „Die haben mich einfach angelächelt.“
An diesem Morgen ist auch der 16-jährige Schlosserhelfer Gerhard F. auf den
Straßen Berlins unterwegs. Wie Herbert P. schaut er gebannt am Potsdamer
Platz auf einen brennenden Lebensmittelladen. Schon am Vorabend hört er von
der Demonstration, sitzt mit Freunden auf einer alten Holzbank an der
Prenzlauer Allee unter einer großen Kastanie. Die Jungen erzählen sich
Witze, reißen Zoten, als ein grauer Kleintransporter durch die Straße in
Ost-Berlin rollt. Auf dem Dach sind zwei Lautsprecher montiert:
„Generalstreik“. Die Jungen wissen nicht, was das bedeutet. Trotzdem
schlüpft Gerhard F. am nächsten Morgen in seine braunen Schuhe, in eine
dunkelgrüne Lederhose und einen blauen Nicki. Er gibt seiner Mutter schnell
noch einen Kuss und tritt vor die Tür der kleinen Wohnung am Prenzlauer
Berg. Über den Lustgarten kommt er zum Potsdamer Platz. Weil Gerhard F. seit
wenigen Tagen Arbeit sucht, kann der Junge den 17. Juni auf der Straße
verbringen.
„Da sind Steine geflogen“, erinnert sich Herbert P.. „Aber ich war lediglich
dabei, habe keine große Rolle gespielt, kam ja aus dem Westen.“ Herbert P.
mag keine Details nennen. „Die anderen Arbeiter waren nicht friedlich. Klar,
dass auch ich dann dabei war. Steine haben aber andere geworfen.“
Die Lage spitzt sich zu, von den Laderäumen grauer Kleintransporter aus
schießen sowjetische Soldaten über die Köpfe der Demonstranten. Die Kugeln
schlagen in Häuserfassaden ein. „Mir spritzte der Mörtel ins Gesicht“, sagt
Gerhard F. Er ist neugierig und versteht die Parolen nicht, die alle
grölen. Er sieht, wie aufgebrachte Arbeiter auf SED-Funktionäre zustürmen,
sie aus ihren schwarzen Autos zerren und in die Spree werfen. Plötzlich
fahren Panzer auf. „Als ich nach Hause wollte, kamen mir zwölf entgegen.“
Der junge Schlosserhelfer läuft durch das Brandenburger Tor, hat Angst vor
den ratternden Ungetümen. Er versteckt sich in einer Ruine am Lustgarten,
kriecht durch Geröll und Schutt in die Kellerräume. Vom Fenster aus sieht er
die sowjetischen Panzer vorbeifahren. Mit Steinen verdeckt er sein Guckloch,
bleibt unentdeckt. Nach zwei Stunden verlässt er sein Versteck, macht sich
auf den Heimweg. An der Prenzlauer Straße trifft er einen großen Mann im
Ledermantel. An diesem Abend kommt Gerhard F. nicht nach Hause.
Die Stasi verfolgt auch Herbert P., sieben Wochen lang sperren sie ihn weg.
Er soll bitter büßen für die Parolen, die er schrie. Doch Herbert P. hat
Glück im Unglück, wird nicht verurteilt. „Mit West-Berlinern sind sie
vorsichtiger umgegangen. Weil die Stasi keine Beweise hatte, musste sie mich
frei lassen.“ Dennoch: Die Zelle 29 in Hohenschönhausen hat er nicht wieder
betreten. „Das kann ich nicht.“ Und noch immer denkt er an den
„Möhreneintopf mit kleinen weißen Fleischstückchen“, den es im Gefängnis zu
essen gab, wenn er sich heute vom Schlachter an der Genslerstraße belegte
Brötchen holt. „Da waren ausgekochte Schweineköpfe drinnen.“ Lange Pausen
gönnt er sich nicht: „Wenn ich durch die Zellen gehe und den Menschen
erkläre, wie das hier früher abgelaufen ist, verarbeite ich meine eigene
Vergangenheit. Das ist wie ein Ventil. Ich habe Mitleid mit denen, die
dieses Ventil nicht haben.“
Rückkehr
Gestern noch hatte Gerhard F. wenig Lust, sich zu erinnern, saß auf einer
Couch in seiner kleinen Wohnung und verfolgte gebannt die Gerichtsshow
„Barbara Salesch.“ Diesen Morgen ist alles anders. Nach seinem Kaffee will
er über sich und seine Vergangenheit sprechen. Hastig isst er seine
Vanilleschnecke im „Allee Center.“ Er ist aus der Routine des Alltags
geworfen und versetzt in den 17. Juni 1953. Was er all die Jahre vergessen
hatte, kommt nun zurück. Er sieht einen kleinen Jungen, der in einer Zelle
kauert, weil er beim Protestmarsch mitlief. Er spricht davon, nicht tauglich
zu sein, Gruppen durch die Gedenkstätte zu führen. „Vielleicht bin ich zu
unbedeutend, vielleicht ist meine Geschichte nicht interessant für die
Leute“.
Herbert P. hat keine Lust mehr, Fragen zu
beantworten. Das Gespräch dauert schon länger als zwei Führungen. Für das
Foto stellt er sich noch schnell neben seine Zelle 29. Das hat er schon oft
gemacht. „Das mache ich solange, bis ich umfalle.“
 ZUM
SEITENANFANG ZUM
SEITENANFANG |
AUSGABE 31
SCHWERPUNKT NETZWERKE

STARTSEITE
EDITORIAL VON BJÖRN
BRÜCKERHOFF
"WIR SIND ANSTÄNDIGE KERLE"
MORITZ HUNZINGER IM GESPRÄCH
SOZIALES KAPITAL UND SEINE RENDITE
ARGENTINIEN AM SCHEIDEWEG
NETZWERK + KULTUR = PPP
GOOGLE NEWS - MEDIALES
WUNDERPRODUKT?
GETEILTES LEID IST HALBES LEID, ODER?
"KIRCH MEDIA"
ALLES
IST EINS
ALLE AUSGABEN IM ARCHIV
PRESSESERVICE
IMPRESSUM

COVER DER AUSGABE 31



 |